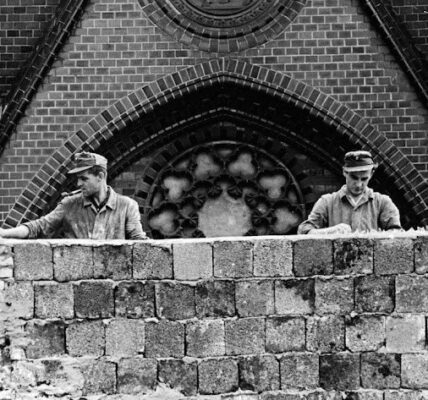Drei Gruppen standen im Mittelpunkt der deutschen Nachkriegsängste vor Rache: jüdische Holocaust-Überlebende, Vertriebene aus Osteuropa und amerikanische Besatzungsbeamte.

Bild oben: Protestmarsch gegen Wohnungsbeschlagnahmungen im hessischen Bad Nauheim in der amerikanischen Besatzungszone, 9. September 1951. Auf dem Transparent dieser Demonstration im hessischen Bad Nauheim steht: „Lasst uns in unsere Häuser, dann wollen wir Freunde sein.“ Bild mit freundlicher Genehmigung der dpa Picture-Alliance, Nr. 28397476.
Im Oktober 1946 zeichneten die amerikanischen Besatzungsbehörden im bayerischen Bad Tölz dieses offen antisemitische und rassistische Gedicht auf:
„Von den Nazis verraten, von den Ami belogen“
Jetzt stehst du mit deinem Besen auf der Straße.
Besser wäre es gewesen, ein richtiger Nazi zu sein.
Der Jude ist ein Schwarzhändler, der Pole ersticht dich.
Aber der Ami sieht es nicht.
Egal, ob du ein Nazi warst oder nicht.
Der Ami wird dich ausrauben und dich nicht verschonen.
Der Ami lässt die Juden herein,
weil er selbst ein jüdisches Schwein ist.
Das Gedicht listete die drei Gruppen auf, die im Zentrum der deutschen Angst vor Vergeltung standen: jüdische Holocaust-Überlebende, osteuropäische Displaced Persons (DPs) und amerikanische Besatzungsbeamte. Es drückte eine paranoide Fantasie aus, in der die angebliche Kriminalität der Holocaust-Überlebenden („Der Jude ist ein Schwarzhändler“) und DPs („Der Pole ersticht dich“) von den US-Besatzungsbeamten toleriert oder sogar gefördert wurde („Aber der Ami sieht es nicht“). Es antizipierte auch eine wahllose Verfolgung Deutscher wegen Nazi-Verbrechen und brachte die antisemitische Vorstellung zum Ausdruck, die Vereinigten Staaten hätten den Zweiten Weltkrieg im Interesse jüdischer Interessen geführt.
Die deutschen Racheängste der Nachkriegszeit spiegelten die beispiellose Eskalation der Gewalt in der Endphase des Zweiten Weltkriegs wider. In den letzten zehn Kriegsmonaten fielen so viele deutsche Soldaten wie in den gesamten vorangegangenen fünf Jahren. Der Monat mit den höchsten deutschen Opferzahlen war der Januar 1945. Auch die alliierten und sowjetischen Opferzahlen erreichten in den letzten Kriegsmonaten einen ähnlichen Höhepunkt.
Diese erschütternden Opferzahlen waren das Ergebnis der Hartnäckigkeit des Nazi-Regimes angesichts einer sicheren militärischen Niederlage. Spätestens 1943 hatte sich das Blatt im Zweiten Weltkrieg mit den deutschen Niederlagen an der Ostfront und in Nordafrika gewendet. Mit dem Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte im Juni 1944 und der gleichzeitigen Landung der Alliierten in der Normandie war die militärische Niederlage Nazideutschlands so gut wie sicher. Doch anders als im November 1918 kapitulierte die deutsche Armee nicht, sondern kämpfte mit unermüdlicher Entschlossenheit und Entschlossenheit weiter.
Die Hartnäckigkeit der deutschen Armee angesichts einer sicheren militärischen Niederlage lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen, darunter die Forderung der Alliierten nach bedingungsloser Kapitulation, die zunehmende terroristische Gewalt des Nazi-Regimes und die ideologische Indoktrination der Wehrmachtssoldaten . Doch auch deutsche Racheängste trugen maßgeblich zur ungebrochenen deutschen Moral in den letzten Kriegsmonaten bei. Diese Ängste rührten von der umfassenden Kenntnis und Beteiligung der nationalsozialistischen Kriegsführung her, insbesondere – aber nicht nur – an der Ostfront. Die Angst vor Rache und die daraus resultierende Bereitschaft, bis zur letzten Minute zu kämpfen, resultierten aus der angstvollen Erwartung, die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs würden den Deutschen dasselbe antun, was die Deutschen zuvor Millionen von Opfern des Nationalsozialismus angetan hatten.
Für viele Deutsche war eine Niederlage im Zweiten Weltkrieg unvorstellbar und sie konnten sich keine Zukunft ohne Hitler vorstellen. Edeltraut G. schrieb im Januar 1945 in ihr Tagebuch: „Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie es sein würde, wenn die Feinde Deutschland im Sturm erobern würden.“ Sie fragte sich: „Was wird nächstes Jahr um diese Zeit sein?“ Einige Monate später, im April und Mai 1945, beschwor Magdalena M. in ihrem Tagebuch wiederholt die Zukunft „in schrecklichen Bildern“ und „düster“. Lili H. gestand im März 1945: „Ich kann mir keine Zukunft vorstellen, weiß nicht, worauf ich mich freuen soll.“
Die Unfähigkeit, sich eine Zukunft ohne den Nationalsozialismus vorzustellen, führte bei manchen Deutschen zum Selbstmord. Im Frühjahr 1945 kam es zu einer Selbstmordwelle unter hochrangigen Nazi-Funktionären, die, wie ihr Führer , der Aussicht entgingen, für ihre Taten im Dritten Reich zur Rechenschaft gezogen zu werden, indem sie sich das Leben nahmen. Die meisten Deutschen begingen jedoch keinen Selbstmord und sahen sich als Mitglieder der deutschen Volksgemeinschaft nun der Bedrohung und Realität alliierter Vergeltungsmaßnahmen gegenüber.
Die deutschen Ängste vor jüdischer Rache drehten sich um die nationalsozialistische Propaganda eines „jüdischen Krieges“. Gegen Kriegsende hatten die Deutschen die antisemitische Vorstellung, der Zweite Weltkrieg sei im Namen einer weltweiten „jüdischen Verschwörung“ geführt worden, fest verinnerlicht. Berichten des Sicherheitsdienstes (SD), des nationalsozialistischen Geheimdienstes, zufolge betrachteten viele Deutsche die Bombardierung deutscher Städte als Vergeltung für die antijüdischen Pogrome vom November 1938, die Reichskristallnacht . Damals waren in ganz Deutschland Synagogen niedergebrannt, Zehntausende Juden verhaftet und Hunderte getötet worden. Nachrichten über sowjetische Gräueltaten in Ostdeutschland veranlassten einige Deutsche auch, Parallelen dazu zu ziehen, „wie wir Tausende Juden ermordet“ und „dem Feind gezeigt haben, was er uns antun kann, wenn er gewinnt“. Die Judenverfolgung lieferte Bilder und Fantasien darüber, was den Deutschen im Falle einer Niederlage widerfahren könnte. Es kursierten Gerüchte, die Alliierten würden die Deutschen zwingen, ein Hakenkreuz auf ihrer Kleidung zu tragen, in Analogie zum Judenstern, den die Nazis den Juden aufgezwungen hatten.
Tatsächliche jüdische Racheakte waren im besetzten Deutschland äußerst selten. Der Holocaust als bürokratisch organisierter Völkermord mit diffuser Verantwortung und oft weit entfernten Tätern erschwerte die Identifizierung lokaler und individueller Opfer solcher Aktionen. Die deutschen Ängste vor jüdischer Rache waren daher weitgehend Fantasie; sie hatten kaum eine Grundlage in der Realität.
Dennoch prägte die Angst vor Vergeltung die Vorstellungen der Deutschen von ihrer Zukunft nach dem Nationalsozialismus. Diese Ängste resultierten auch aus der Tatsache, dass die Zahl der jüdischen Überlebenden im Nachkriegsdeutschland paradoxerweise rapide von nur 20.000 im Jahr 1945 auf 250.000 im Jahr 1947 anstieg. Dies war vor allem auf den Zustrom polnischer Juden zurückzuführen, die den Krieg in der Sowjetunion überlebt hatten und dann vor einer Reihe antisemitischer Pogrome im Nachkriegspolen geflohen waren. Die Deutschen ärgerten sich über die bessere Behandlung, die die amerikanischen Besatzungsbehörden den jüdischen Überlebenden gewährten – beispielsweise höhere Nahrungsmittelrationen und bevorzugte Wohnverhältnisse.
Für viele Deutsche erschien die Nachkriegsgesellschaft wie eine verkehrte Welt, in der zuvor verachtete Menschen dank des Schutzes der amerikanischen Besatzungsbehörden einen höheren Status zu genießen schienen. Selbst der Gesichtsausdruck jüdischer Überlebender schien diese neue, angstauslösende Gesellschaftsordnung widerzuspiegeln. „Viele Ausländer laufen grinsend durch die Stadt, wer weiß, wie sie sich jetzt verhalten werden?“, schrieb Edeltraut G. im April 1945 in ihr Tagebuch. Das selbstbewusste Auftreten der Überlebenden in der Öffentlichkeit stand im krassen Gegensatz zur (Selbst-)Einschüchterung der einfachen Deutschen, die sich gezwungen sahen, ihre nationale Identifikation herunterzuspielen.
„Wir sind keine Deutschen mehr oder dürfen es zumindest nicht zeigen.“
Edeltraut G, einen Tag nach dem vorherigen Eintrag
Die Deutschen empfanden einen solchen Rollentausch auch als direkte Bedrohung ihrer persönlichen Sicherheit. Im Herbst 1945 kursierten Gerüchte, dass „am 8. oder 9. November alle Ausländer das Recht hätten, ohne Furcht oder Schaden zu plündern und zu brandschatzen“. Die amerikanischen Besatzungsbehörden hielten diese Gerüchte für so wichtig, dass sie sie per Dementis zurückwiesen und in diesem Zusammenhang einen Mann verhafteten. Es ist kein Zufall, dass es am 9. November, dem Jahrestag der Reichskristallnacht , zu Plünderungen kam . Als öffentlich sichtbarer und offener Gewaltakt gegen Juden prägte dieses Ereignis die Schuldgefühle der Deutschen und damit auch die Angst vor Rache.
Diese emotionale Dynamik führte gelegentlich auch zu offener Gewalt, wie etwa im April 1946 in Landsberg, als Gerüchte über die deutsche Entführung jüdischer DPs jüdische Angriffe auf deutsche Zivilisten provozierten. Doch dieser Vorfall war eine seltene Ausnahme. Die deutschen Ängste vor gewaltsamer jüdischer Rache erwiesen sich größtenteils als unbegründet. Diese Ängste blieben eher ein Hirngespinst als eine empirische Realität im Nachkriegsdeutschland.

Demonstration jüdischer Displaced Persons in Frankfurt am Main, 1945. Bild mit freundlicher Genehmigung der bpk-Bildagentur, Nr. 30050504.
Diese Diskrepanz zwischen Realität und Fantasie war im Fall der Displaced Persons aus Osteuropa nicht ganz so ausgeprägt. Aufgrund des nationalsozialistischen Rassismus waren polnische und russische Zwangsarbeiter oft grauenhaften Bedingungen ausgesetzt. Wie bei den jüdischen Überlebenden hielten die deutschen Ängste vor den Displaced Persons bis in die letzten Kriegsjahre an, als Gerüchte über einen Aufstand ausländischer Arbeiter kursierten. Nach der deutschen Niederlage feierten ehemalige Zwangsarbeiter ihre Befreiung mit karnevalesken Aktionen rund um Alkohol, Sex und Essen.
Einem Bericht der Nürnberger Lokalpresse zufolge marschierten im Mai 1945 ehemalige russische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter betrunken und in „feindseliger und aggressiver“ Haltung durch die Stadt. Sie drangen in den Nürnberger Zoo ein, wo einige von ihnen während des Krieges gearbeitet hatten, und töteten „herzlos und gnadenlos … wehrlose und verängstigte Tiere“, darunter ein Reh, einen Bären und sogar einen Löwen. Die symbolische Bedeutung des Vorfalls war offensichtlich: Wie die Tiere im Nürnberger Zoo waren auch die verängstigten Nürnberger Bürger potenzieller Gewalt und Rachsucht ehemaliger Zwangsarbeiter ausgesetzt, ohne auf den Schutz der US-Besatzungstruppen zählen zu können.
Doch die Gewalt der DPs war weder eingebildet noch symbolisch. Stattdessen beschwerten sich deutsche Beamte ständig über marodierende „Ausländer“, die meist als „Polen“, „Russen“ oder „Ukrainer“ bezeichnet wurden, manchmal auch als „KZ-Häftlinge“. Der Regierungspräsident von Ansbach in der amerikanischen Besatzungszone berichtete von „nächtlichen Raubüberfällen“ durch „Polenbanden“, die mit Maschinengewehren auf die unbewaffnete und widerstandslose Bevölkerung schossen.
„Mord, Körperverletzung, Folter und Vergewaltigung der Bewohner der betroffenen Farmen sind ständige Begleiterscheinungen dieser Plünderungsepisoden.“
Regierungspräsident , Ansbach
Im Oktober 1945 drangen 30 Polen in das Haus von Theodor E. in Heimbuchtal ein, ermordeten ihn und seinen kriegsversehrten Sohn, verübten Gewalt gegen seine Tochter und einen Landarbeiter und raubten das Haus aus. Die Bevölkerung reagierte auf diese Morde mit „großer Verbitterung“ und „lähmender Angst“. Bewohner abgelegener Bauernhöfe waren besonders gefährdet, Ziel solcher Angriffe zu werden und berichteten daher von besonderer Angst.
Die Gewalt der DPs gegen einfache Deutsche beruhte auf verschiedenen Faktoren. Oftmals verübten geflohene oder ausgebombte Zwangsarbeiter Plünderungen und Raubüberfälle, um zu überleben. Sie stahlen meist Lebensmittel und wurden nur gegenüber Deutschen gewalttätig, die ihnen diese verweigerten. In anderen Fällen sehnten sich ehemalige Zwangsarbeiter jedoch explizit nach Rache. Sie waren in einer besseren Position als jüdische Holocaust-Opfer, da sie oft die Identität ihrer Peiniger kannten. In Pullach wurde ein ehemaliger Mitarbeiter des Isarkraftwerks Berichten zufolge von „seinen Zwangsarbeitern“ getötet, weil er sie „schlecht behandelt“ hatte. Auch ehemalige Vorgesetzte der DPs – „Vorarbeiter, Lagerkommandanten oder Werkswächter“ – wurden häufig Ziel von DP-Gewalttaten.
Eine Frau berichtete im November 1945, dass „die Polen“ im Rahmen einer Serie „grausamer Morde, Überfälle und Raubüberfälle“ einen Bauern erschossen hätten und einem anderen mit dem Tode drohten, wenn er nicht den „Nachlohn“ für fünf Jahre Sklavenarbeit zahle. Ehemalige Fremdarbeiter nutzten ihre Ortskenntnisse und nahmen diejenigen ins Visier, die sie während des Krieges misshandelt und gefoltert hatten. DPs übten auch indirekt Rache. Ein deutscher Beamter berichtete von einem Raubüberfall und einer Plünderung eines Bauernhofs in Mehring im Landkreis Altöttingen durch 10–15 Personen und zitierte eine häufige Rechtfertigung, „insbesondere von Polen“, dass die „deutsche SS dasselbe getan habe“.
Angetrieben von hartnäckigen Stereotypen von Osteuropäern als „Kriminelle“, übertrieben panische Deutsche das Ausmaß der tatsächlichen DP-Gewalt deutlich. Die DP-Kriminalität blieb in der unmittelbaren Nachkriegszeit gleich oder knapp unter der allgemeinen deutschen Kriminalitätsrate und lag bis 1947 nur geringfügig darüber. Berichte über DP-Gewalt wurden in deutschen Quellen aufgrund verschiedener Faktoren aufgebauscht. Deutsche Bauern erfanden gelegentlich angebliche DP-Überfälle, um den Verkauf ihres Viehs auf dem Schwarzmarkt zu verschleiern.
Polizeiberichte überhöhten zudem konsequent die Kriminalität der DPs, um die Besatzungsbehörden zum Ausbau und zur Wiederbewaffnung der deutschen Sicherheitskräfte zu bewegen. Die Deutschen machten die DPs für ihr eigenes Gefühl der Hilflosigkeit verantwortlich und stellten sie als „aktives, aggressives und kriminelles Gegenstück zur deutschen Gesellschaft“ dar. Die DPs selbst protestierten gegen die Pressekampagne, die sie als „Kriminelle“ und „Faschisten“ darstellte. Es ist tatsächlich wichtig zu betonen, dass die überwiegende Mehrheit der DPs nie Gewalt anwendete.

Displaced Persons, 1945. Bild mit freundlicher Genehmigung der bpk-Bildagentur, Nr. 30050648.
Dennoch erlangten einzelne Gewalttaten der DPs eine unverhältnismäßige symbolische Bedeutung. Geschichten über DP-Gewalt tendierten dazu, bereits bestehende deutsche Ängste vor den Folgen einer Niederlage zu bestätigen und zu verstärken. Und die Angst vor Vergeltung durch DPs basierte zumindest teilweise auf tatsächlichen Ereignissen. Zwar übertraf die deutsche Vorstellung von DP-Gewalt die tatsächliche Realität, doch verliehen diese Ereignisse den Nachkriegsängsten vor Vergeltung zumindest eine gewisse Glaubwürdigkeit. Gerüchte über weit verbreitete DP-Gewalt waren ansteckend, und die Angst vor Vergeltung betraf daher auch diejenigen, die nie Gewalt durch DPs erlebt hatten.
Vorhandene und noch immer bestehende rassistische Stereotype über „Polen“ und „Russen“ sowie das weit verbreitete Wissen über die tatsächlichen Nazi-Gräueltaten schürten die Angst vor Vergeltungsmaßnahmen. Die Bedrohung und die Vorstellung von DP-Gewalt verstärkten das allgemeine Klima der Unsicherheit und Unsicherheit in der unmittelbaren Nachkriegszeit. „So schlimme Zustände wie jetzt haben wir in Bayern noch nie erlebt, nicht einmal während des Krieges“, berichtete ein Beamter.
Eine der Hoffnungen, die die Deutschen mit der Ankunft der Besatzungsbehörden verbanden, war die Wiederherstellung der Ordnung und ein neues Gefühl persönlicher Sicherheit. Doch viele waren schockiert, als sie erkannten, dass die Nachkriegsbesatzung diese Ängste nicht linderte, sondern sie mit neuen Bedrohungen und Herausforderungen konfrontierte.
Die Deutschen hatten seit den Napoleonischen Kriegen im frühen 19. Jahrhundert keine vollständige Fremdherrschaft mehr erlebt. Die Nachkriegsdeutschen waren nun völlig von den alliierten Siegern abhängig und besaßen nicht mehr die ersehnte Selbstbestimmung, die nach 1945 mit dem Beginn der Entkolonialisierung weltweit neue Bedeutung erlangte. Immer wieder beschworen deutsche Zeugenaussagen aus dem Frühjahr 1945 das Schreckgespenst der „Sklaverei“. Lore N. aus Sachsen schrieb beispielsweise im März 1945 an ihren Freund Fritz E. in Schlesien, sie wolle „nicht als Sklavin für ein anderes Volk arbeiten, dann hätten wir keinerlei Freude am Leben“. Für viele Deutsche bedeutete die Fremdherrschaft einen beispiellosen Sprung ins Ungewisse.
Die Angst vor alliierter Rache richtete sich insbesondere gegen die „Russen“. Sowjetische Gräueltaten während der Eroberung Deutschlands, insbesondere die Massenvergewaltigung von bis zu zwei Millionen deutschen Frauen durch Soldaten der Roten Armee, bestätigten diese Ängste, die oft auf einer durch und durch rassistischen Vorstellung basierten. Thea D. (Jahrgang 1928) beschrieb den Einmarsch der Roten Armee in Leipzig als „tierhafte Gesichter der Asiaten“, die für sie „unkultivierte Menschlichkeit“ darstellten.
Aus Angst unternahmen deutsche Soldaten und Zivilisten verzweifelte Anstrengungen, die britischen und amerikanischen Linien zu erreichen, um der Roten Armee zu entkommen. Einige Deutsche äußerten auch große Erleichterung, ja sogar Freude und Glück darüber, unter amerikanischer und nicht sowjetischer Besatzung zu stehen.
„Sie sind da“, notierte eine Heidelbergerin im März 1945 in ihrem Tagebuch über die amerikanischen Truppen, „jetzt brauchen wir keine Angst mehr zu haben. […]. Wir können wieder atmen.“
Trotz der weit verbreiteten Bevorzugung der Westalliierten empfanden viele Deutsche die Besatzung insgesamt als massive Bedrohung für ihr Leben und ihre Zukunftsvorstellungen. Gerüchte über sowjetische Gräueltaten verstärkten die Angst der Deutschen vor Vergeltungsmaßnahmen der Alliierten. Am 6. Mai 1945 notierte die 20-jährige Renate P. in ihrem Tagebuch:
„Unsere schlimmsten Befürchtungen haben sich in den letzten Tagen bewahrheitet. Deutschland hat die unehrenhafteste und jämmerlichste Niederlage seit Jahrhunderten erlebt und wurde von den drei mächtigen Feindmächten Russland, Amerika und England vollständig besiegt und zu Boden geworfen – Deutschland ist besetzt, ausgelöscht, es wird und wird in der ganzen Welt verachtet, das Land und sein Volk werden gemieden und verachtet.“
Auch amerikanische Soldaten sahen sich nicht als Befreier der Deutschen, sondern als Sieger und Besatzer. Die wichtigste Direktive des Joint Chiefs of Staff unter General Eisenhower, JCS 1067, forderte eine strafende und harte Behandlung besiegter Deutscher. Anweisungen an einzelne amerikanische Soldaten im Pocket Guide to Germany (Kursivschrift) lauteten unmissverständlich: „Sie befinden sich in Feindesland. Diese Leute sind nicht unsere Verbündeten oder Freunde.“
Richtlinien für das Verhalten der Truppen warnten, dass „die Mehrheit der Deutschen die Nazis unterstützte“ und dass deutsche Zivilisten „versuchen würden, sich mit uns anzufreunden – um Informationen zu bekommen, Gefälligkeiten zu erlangen, Mitgefühl für das ‚arme, unterdrückte‘ deutsche Volk zu wecken, uns untereinander zu spalten oder einfach nur eine gute Gelegenheit zu bekommen, alliierten Soldaten ein Messer in den Leib zu rammen.“
Eine Meinungsumfrage unter US-Soldaten im April 1945 ergab, dass 76 Prozent deutsche Zivilisten „hassten“ oder ihnen „negative Gefühle“ entgegenbrachten, während 71 Prozent der Soldaten der Meinung waren, „alle oder die meisten Deutschen“ seien für den Krieg verantwortlich. Die Entdeckung und Befreiung der Konzentrationslager im darauffolgenden Monat verstärkte diese negativen Gefühle höchstwahrscheinlich noch. Welche Hoffnungen auch immer einzelne Deutsche mit der Ankunft der amerikanischen Besatzungstruppen 1945 verbunden hatten, diese positiven Gefühle waren nicht erwidert.
Zwar verbesserte sich das Verhältnis zwischen Deutschen und amerikanischen GIs schrittweise und bereitete schließlich den Boden für die spätere Integration der Bundesrepublik in das westliche Bündnis während des Kalten Krieges . Doch die Deutschen damals konnten diese Entwicklung nicht vorhersehen. Sie erlebten die US-Besatzung vielmehr als massiven Eingriff in ihr Privatleben. Vor allem drei Bereiche lösten in der Bevölkerung Ängste und Sorgen aus: Gewaltverbrechen amerikanischer Besatzungssoldaten, Wohnungsbeschlagnahmungen und die beginnende Entnazifizierung.
Eine Quelle der Nachkriegsangst waren amerikanische Gewalttaten gegen deutsche Zivilisten. Angesichts der Heftigkeit der Kämpfe in der Endphase des Krieges waren derartige Gewaltverbrechen nicht überraschend. Schwere Verbrechen wie „Mord, Vergewaltigung, Raub, Diebstahl, Schwarzmarktdelikte usw.“ stiegen Berichten zufolge von 3,7 pro 10.000 Soldaten im August 1945 auf 11,1 pro 10.000 Soldaten im Januar 1946. Die Gewalt der GIs gegen deutsche Zivilisten nahm vielfältige Formen an. Einige Übergriffe fanden am helllichten Tag statt und dienten dazu, einzelne Deutsche wegen ihrer Komplizenschaft mit dem Nationalsozialismus öffentlich zu demütigen.
Im Juli 1945 drangen amerikanische Soldaten in das Haus des ehemaligen Soldaten Georg W. ein, schlugen ihm ins Gesicht und zwangen ihn, am helllichten Tag nackt am Fenster zu stehen. Andere Fälle ereigneten sich jedoch nachts und waren nicht so öffentlich. GIs näherten sich scheinbar willkürlich deutschen Zivilisten, hielten sie an, baten sie um Zigaretten, Alkohol, Geld oder vielleicht eine Mitfahrgelegenheit und verprügelten sie dann, was oft zu schweren Verletzungen führte.
In mehreren Fällen, die im Herbst 1946 aus Amberg gemeldet wurden, drangen betrunkene GIs auch in deutsche Häuser ein, verlangten Alkohol oder Mädchen oder stellten ihre Überlegenheit mit gezückten Pistolen unter Beweis. Ein rapider Anstieg der Autounfälle mit Beteiligung amerikanischer GIs – laut einer Quelle 7.800 zwischen Juni und November 1945 – signalisierte mangelnde Disziplin unter den Besatzungstruppen. Ein Einwohner der hessischen Stadt Marburg sprach für viele, als er im März 1946 über willkürliche und gewalttätige Übergriffe amerikanischer Besatzungstruppen auf deutsche Zivilisten, darunter mehrere Universitätsprofessoren, klagte.
„Diese Übergriffe“, fügte er hinzu, „sind unter der Zivilbevölkerung Marburgs berüchtigt; niemand wagt es, abends auszugehen, und die Menschen haben das Gefühl, schutzlos wahlloser Brutalität ausgesetzt zu sein.“
Sexuelle Übergriffe, einschließlich Vergewaltigungen, waren auch im Verhältnis zwischen amerikanischen GIs und deutschen Zivilisten fester Bestandteil. US-Kriegsgerichtsakten dokumentierten 552 Fälle von Vergewaltigung deutscher Frauen durch amerikanische Soldaten. Dies war deutlich weniger als die vergleichbaren Zahlen in der Sowjetzone, obwohl andere Schätzungen auch von höheren Zahlen sprechen, die zwischen Januar und Dezember 1945 bis zu 1.500 Vergewaltigungen umfassen. In beiden Zonen liefen die Vergewaltigungen nach einem ähnlichen Schema ab: Sie resultierten oft aus der Frustration der Soldaten über exzessive Gewalt und die Hartnäckigkeit der Deutschen in der Endphase des Krieges; Soldaten betrachteten deutsche Frauen als Teil eines besiegten und unterdrückten Volkes; sexuelle Gewalt diente der Rache durch die Demütigung deutscher Männer.
Die sexuellen Beziehungen afroamerikanischer Soldaten mit deutschen Frauen waren für die Deutschen ein besonderes Problem. Solche Beziehungen aktivierten bereits vorhandene rassistische Einstellungen deutscher Zivilisten. „Es gibt Gerüchte, dass bald Neger als Besatzungstruppen eintreffen werden“, schrieb Edeltraut G. im April 1945 in ihr Tagebuch. „Das wird schrecklich, dann kann man als Mädchen nicht mehr auf die Straße gehen.“ Zweifellos aufgrund ihrer eigenen rassistischen Einstellungen in einer noch immer segregierten Armee neigten (weiße) amerikanische Besatzungsbeamte dazu, deutschen Beamten und Bürgern zuzustimmen.
Afroamerikanische GIs wurden zum Sündenbock für Spannungen zwischen amerikanischen Truppen aufgrund solcher Stimmungen. Offizielle Statistiken der US-Armee deuteten auf eine deutlich höhere Rate „schwerer Zwischenfälle“ unter „farbigen“ Soldaten hin als unter weißen, was mit ziemlicher Sicherheit auf rassistische Selektivität hindeutete. Die Deutschen wiederum lernten schnell, dass bestimmte Formen des Rassismus durchaus mit der amerikanischen Militärherrschaft vereinbar waren. Doch selbst die eingeschränkte Autorität der afroamerikanischen GIs als Besatzer bestätigte die deutsche Wahrnehmung der Besatzungszeit als einer verkehrten Welt.
Wohnungsbeschlagnahmungen waren ein weiterer Grund für die Ängste der Nachkriegsdeutschen. Wohnraum war im besetzten Deutschland ein äußerst knappes Gut. In Städten wie Würzburg waren drei Viertel des Wohnungsbestands durch alliierte Bombenangriffe zerstört; der Durchschnitt aller vier Besatzungszonen lag bei etwa 30 Prozent. Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und die allmähliche Rückkehr deutscher Kriegsgefangener heizten die Nachfrage nach Wohnraum zusätzlich an. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Deutschen die Wohnungsbeschlagnahmungen durch die Besatzungsarmee als schwere Belastung empfanden.
In München berichtete Bürgermeister Karl Scharnagel im Dezember 1946 dem Stadtrat: „In allen Teilen der Stadt wächst die Sorge, dass jede Straße, jedes Haus vom gleichen Schicksal [der Beschlagnahmung, FB] getroffen werden könnte.“ Gerüchte und Nachrichten über weitere Beschlagnahmungen lösten in der Bevölkerung große „Besorgnis, Angst und Verbitterung“ aus; und die Münchner verkündeten öffentlich ihre Angst vor dem „Gespenst der Beschlagnahmung von Häusern und Bauernhöfen“. Selbst jene Deutschen, die die amerikanische Besatzung zunächst begrüßt hatten, fürchteten den Verlust ihrer Heimat.
Im April 1945 notierte Evamaria Küchling-Marsdem in ihrem Tagebuch:
Durch die Ankunft der amerikanischen Truppen sei „das Leben in Heidelberg wieder normal geworden“. Dennoch fügte sie sofort hinzu: „Wir befürchten die Beschlagnahmung unserer Heimat.“
Evamaria Küchling-Marsdem
Die Tatsache, dass das amerikanische Militär Häuser für Juden, DPs und andere Nazi-Opfer beschlagnahmte, verschärfte den deutschen Groll. Als die amerikanische Militärregierung im Dezember 1945 die Beschlagnahmung von 240 kleinen Häusern in der Siedlung Kaltererberge für 2.000 jüdische Holocaust-Überlebende anordnete, kam es zu weit verbreiteten öffentlichen Protesten. Die Deutschen warfen den neuen Bewohnern vor, keine Nazi-Opfer, sondern „illegal eingewanderte und arbeitsscheue Elemente“ zu sein, die auf dem Schwarzmarkt und in anderen kriminellen Aktivitäten tätig seien. Die Empörung über die Beschlagnahmungen schlug auch in Gewalt gegen Juden um. So brach beispielsweise ein ehemaliger SS-Führer in seine Wohnung ein, die einem polnischen Paar überlassen worden war. Die amerikanischen Besatzungsbeamten versuchten, das Mitgefühl der Deutschen für jüdische Holocaust-Überlebende zu wecken, doch deutsche Zivilisten und Beamte zeigten für diese Argumente wenig Verständnis.
Das einzige offizielle Programm, das einzelne Deutsche stärker betraf als die Beschlagnahmung von Wohnungen, war die Entnazifizierung, ein Prozess, der den Nazi-Einfluss aus dem besiegten Land beseitigen sollte. Historiker betrachten die von den USA angeführte Entnazifizierung seit langem als kläglichen Misserfolg. Obwohl gut gemeint, führte sie letztlich dazu, ehemalige Nazis reinzuwaschen.
Von den 900.000 Entnazifizierungsverfahren in der US-amerikanischen Besatzungszone wurden lediglich 1.654 Personen (0,17 Prozent) als „schwere Straftäter“, 22.122 (2,33 Prozent) als „Straftäter“ und 106.422 als „leichte Straftäter“ eingestuft. Die personelle Kontinuität im öffentlichen Dienst, bei der Polizei, im Bildungswesen und insbesondere in der Rechtsanwaltschaft wurde durch die Entnazifizierung somit nicht nennenswert beeinträchtigt.
Doch das langfristige Versagen, eine umfassende Säuberung ehemaliger Nazis durchzuführen, sagt wenig über die subjektiven Erfahrungen der Entnazifizierung damals aus. Für viele Deutsche bestätigte der Beginn der Entnazifizierung einige ihrer schlimmsten Befürchtungen vor alliierten Vergeltungsmaßnahmen. „Wie die Nazis jetzt Angst haben“, schrieb eine Frau aus Hamburg am 7. Mai in einem Brief und fügte schnell hinzu: „Hoffentlich schnappen sie jetzt die Richtigen.“
Erste Entnazifizierungsmaßnahmen in der amerikanischen Besatzungszone untergruben die Hoffnungen der Alliierten, „echte Nazis“ identifizieren zu können. Die Besatzungsdirektive JCS 1067 sah die Entlassung aller NSDAP-Mitglieder aus öffentlichen Ämtern sowie die „automatische Verhaftung“ von Kriegsverbrechern und NSDAP-Funktionären bis auf die lokale Ebene vor. Das Militärregierungsgesetz Nr. 8 vom März 1946 erweiterte den Kreis der Betroffenen und verlangte die Entlassung aller Mitglieder der NSDAP und ihrer angeschlossenen Organisationen vor 1937.
Angesichts der breiten Unterstützung des Nationalsozialismus hatten diese Bestimmungen erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Nachkriegsgesellschaft. Bis Ende 1945 wurden rund 100.000 Menschen verhaftet und in der amerikanischen Zone interniert, während bis März 1946 weitere 340.000 Menschen ihren Arbeitsplatz verloren, mehr als die Hälfte davon Beamte. Infolgedessen brachen die lokalen Verwaltungen praktisch zusammen. In München betraf die Entnazifizierung ein Viertel aller städtischen Angestellten, in Würzburg bis zu 70 Prozent, darunter bis August 1945 92 Prozent aller Lehrer. Die deutschen Gemeinden hatten infolge der Entnazifizierung Schwierigkeiten, öffentliche Dienstleistungen aufrechtzuerhalten. Wahllose Verhaftungen schürten den starken Widerstand der deutschen Bevölkerung und untergruben die anfängliche Unterstützung für die Entnazifizierung.
Bereits im August 1945 berichtete der Würzburger Regierungspräsident , dass die „Maßnahmen gegen die NSDAP und ihre Mitglieder in der Bevölkerung keine moralische Unterstützung finden“. Auch christliche Kirchen mobilisierten gegen die Entnazifizierung, und Kirchenvertreter wurden zu den wichtigsten Wortführern des Widerstands in der Bevölkerung. So verurteilte beispielsweise der süddeutsche protestantische Bischof Wurm im Oktober 1945 die Entnazifizierung als Ausdruck alliierter „Rache und Vergeltung“ und wandte sich – in einer Sprache, die bewusst an die nationalsozialistische Judenverfolgung erinnerte – insbesondere gegen die „undifferenzierte Auslöschung aller nationalsozialistischen Beamten“.
Da die Entnazifizierung der Wirtschaft nach denselben Kriterien erfolgte wie die formelle Parteimitgliedschaft, sorgten sich Berichten zufolge viele Deutsche um ihren „Besitz“ und fürchteten, zu den „Gesetzlosen und Enteigneten“ zu gehören. Ein Bericht aus Würzburg behauptete im Januar 1946, die Entnazifizierung betreffe 50 Prozent aller Einwohner der Stadt, und forderte die Besatzer auf, „den Menschen ihre Angst zu nehmen“.
Die öffentliche Meinung zur Entnazifizierung änderte sich nicht wesentlich, als die Entnazifizierung im März 1946 in deutsche Hände überging. Lokale Spruchkammern , bestehend aus ehemaligen deutschen Nazigegnern, übernahmen die Bearbeitung der Einzelfälle. Das „Gesetz zur Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus“ verpflichtete alle Einwohner ab 18 Jahren, sich zu ihrer politischen Vergangenheit zu äußern.
Mehr als 13 Millionen Deutsche füllten den Fragebogen zur Entnazifizierung aus. Mehr als ein Viertel, also 3.441.800 Personen, mussten sich einer formellen Entnazifizierung unterziehen, weil sie Mitglieder der NSDAP oder einer ihrer Organisationen gewesen waren. Ein abgeschlossenes Entnazifizierungsverfahren war Voraussetzung für die Aufnahme einer Tätigkeit, die über eine manuelle Arbeit hinausging. Da sich die Entnazifizierung überwiegend an Männer der Mittelschicht richtete, bedeutete diese Klausel den vorübergehenden Ausschluss eines großen Teils der gebildeten männlichen Mittelschicht von einflussreichen Positionen.
Es überrascht nicht, dass die von der Entnazifizierung Betroffenen wütend und trotzig auf diese Sanktionen reagierten. In seinem Roman Der Fragebogen verhöhnte der bekannte rechtsextreme Aktivist der Zwischenkriegszeit, Ernst von Salomon, das gesamte Entnazifizierungsverfahren. Die Tatsache, dass dieses Buch zum erfolgreichsten Bestseller der frühen Nachkriegszeit wurde, zeigt, wie tief die damalige Ablehnung der Entnazifizierung in den Deutschen war.
In ihrem „Bericht aus Deutschland“ von 1950 stellte die deutsch-jüdische Philosophin Hannah Arendt fest, dass die Nachkriegsdeutschen eine „echte Unfähigkeit zu fühlen“ und einen „allgemeinen Mangel an Emotionen“ zeigten. Die intensiven Ängste vor Vergeltung, die die Deutschen in der unmittelbaren Nachkriegszeit äußerten, widersprechen dieser Aussage. Racheängste und die Angst vor einer ungewissen individuellen und kollektiven Zukunft waren für die Nachkriegsdeutschen nach dem „Dritten Reich“ eine grundlegende Erfahrung.
Angst vor Vergeltung prägte die Erfahrung der Nachkriegsdeutschen mit ihrer Niederlage und prägte ihre Zukunftserwartungen. Die emotionale Funktion dieser Vergeltungsängste war komplex und widersprüchlich: Angst diente sowohl als verschleierter Ausdruck von Schuld als auch als Abwehrmechanismus dagegen. Einerseits gehörten das umfassende Wissen über die NS-Verbrechen und ein daraus resultierendes klares Schuldgefühl zu den Ursachen der Angst.
Andererseits verhinderten private und öffentliche Äußerungen von Angst und Sorge eine umfassendere Selbstreflexion und ein Schuldeingeständnis. Die tatsächlichen und eingebildeten Folgen dieser Schuld erschienen vielen Deutschen zu schwerwiegend. So verzögerte die Angst vor Vergeltung eine umfassendere Auseinandersetzung mit der tatsächlichen Katastrophe, die die Deutschen für die Millionen Opfer des Nationalsozialismus verursacht hatten.