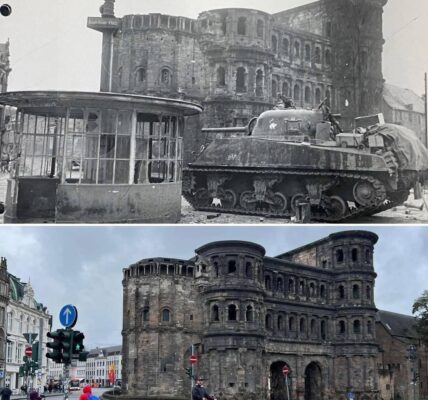Deutsche logistische Probleme
Ein weiterer enorm wichtiger Faktor fur die deutsche Niederlage war die Logistik. Egal wie schnell und weit die kämpfenden Verbände vorruckten, sie waren auf rechtzeitige Versorgung mit Treibstoff und Munition angewiesen.
Dies wurde zu einem noch größeren Problem, als die Armee tiefer in sowjetisches Gebiet vordrang und sich immer weiter von ihren eigenen Endbahnhöfen entfernte.
Nicht nur waren die Entfernungen viel größer als während des Frankreichfeldzugs, auch die sowjetische Transportinfrastruktur war viel schlechter.
Die deutschen Ingenieure bemuhten sich, die russische Spurweite auf eine Spurweite umzustellen, die fur ihre eigenen Lokomotiven und Fahrzeuge geeignet war.

Ein finnischer Truppenzug fährt durch den Schauplatz einer Explosion, bei der am 19. Oktober 1941 ein Zug zerstört und die Gleise und der Bahndamm aufgerissen wurden.
Unterdessen waren die zahlreichen Lastwagen und Pferdewagen, mit denen die Vorräte transportiert wurden, gezwungen, russische Feldwege zu befahren, die nach anhaltendem Regen praktisch unpassierbar waren.
Die schwächenden Auswirkungen des Wetters und des Geländes wurden bei der Planung des Feldzugs nicht ausreichend berucksichtigt. Die zahlreichen Wälder, Sumpfe und Flusse verlangsamten den Vormarsch im Sommer.
Der Herbsteinbruch Rasputiza und der Beginn des brutalen russischen Winters brachten die Operation „Taifun“ zum Stillstand. Tank- und Fahrzeugschmierstoffe gefroren, als die Temperaturen auf Rekordtiefs sanken.
Die Versorgung mit Winterkleidung wurde in Polen aufgehalten, da Treibstoff und Munition Vorrang hatten.
Wenn irgendetwas das Scheitern von „Barbarossa“ symbolisiert, dann ist es das Bild der unzureichend ausgerusteten deutschen Truppen, die vor Moskau im Schnee zitterten.

Brennende Häuser, Ruinen und Wracks zeugen von der Heftigkeit der Schlacht, die diesem Moment vorausging, als die deutschen Truppen am 22. November 1941 in das hartnäckig verteidigte Industriezentrum Rostow am Unterlauf des Don in Russland einmarschierten.

General Heinz Guderian, Kommandeur der deutschen Panzergruppe 2, unterhält sich am 3. September 1941 mit Mitgliedern einer Panzerbesatzung an der russischen Front.

Während ihres Eroberungsfeldzugs durch Russland am 18. Juli 1941 entfernen deutsche Soldaten eines der vielen sowjetischen Nationalsymbole.

Das Bild zeigt einen Mann, seine Frau und sein Kind, nachdem sie am 9. August 1941 Minsk verlassen hatten, als die deutsche Armee einmarschierte. Die ursprungliche Bildunterschrift aus Kriegszeiten lautet unter anderem: „In den Augen des Mannes brennt Hass auf die Nazis, während er sein kleines Kind im Arm hält, während seine Frau völlig erschöpft auf dem Burgersteig liegt.“

Deutsche Beamte behaupteten, dieses Foto sei eine Fernkameraaufnahme Leningrads, aufgenommen von den deutschen Belagerungslinien am 1. Oktober 1941. Die dunklen Formen am Himmel wurden als sowjetische Patrouillenflugzeuge identifiziert, es handelte sich aber wahrscheinlicher um Sperrballons. Dies markierte den weitesten Vorstoß der Deutschen in die Stadt. Sie belagerten Leningrad noch uber zwei Jahre lang, konnten die Stadt jedoch nicht vollständig einnehmen.

Eine Flut russischer Panzerwagen bewegt sich am 19. Oktober 1941 Richtung Front.

Finnische Soldaten sturmen am 10. August 1941 einen sowjetischen Bunker. Ein Mitglied der sowjetischen Bunkerbesatzung ergibt sich (links).

Am 24. November 1941 marschieren deutsche Truppen hastig durch einen brennenden Vorort Leningrads in Russland.

Russische Kriegsgefangene, die am 7. Juli 1941 von den Deutschen gefangen genommen wurden.

Eine Kolonne russischer Kriegsgefangener, die während der jungsten Kämpfe in der Ukraine gefangen genommen wurden, auf dem Weg in ein Nazi-Gefangenenlager am 3. September 1941.

Deutsche Panzertruppen ruhen sich am 21. November 1941 in Stariza, Russland, aus. Sie waren gerade erst von den Russen geräumt worden, bevor sie den Kampf um Kiew fortsetzten. Die zerstörten Gebäude im Hintergrund zeugen von der konsequenten russischen Politik der verbrannten Erde.

Am 1. September 1941 dringen deutsche Infanteristen in ein Scharfschutzenversteck ein, von wo aus die Russen auf vorruckende deutsche Truppen geschossen hatten.

Zwei russische Soldaten, inzwischen Kriegsgefangene, untersuchen am 9. August 1941 irgendwo in Russland eine riesige Lenin-Statue, die von den Deutschen bei ihrem Vormarsch von ihrem Sockel gerissen und zertrummert wurde. Beachten Sie das Seil um den Hals der Statue, das die Deutschen dort symbolisch zuruckgelassen haben.

Deutsche Quellen beschrieben den duster dreinblickenden Offizier auf der rechten Seite als einen gefangenen russischen Oberst, der am 24. Oktober 1941 von Nazi-Offizieren verhört wird.

Im Hintergrund schießen Flammen aus brennenden Gebäuden, als deutsche Truppen im August 1941 während ihres Angriffs auf die Hauptstadt Moskau in die Stadt Smolensk in der Mitte der Sowjetunion einmarschieren.

Deutsche Quellen beschrieben diesen Zug als sowjetische Kriegsgefangene auf dem Weg nach Deutschland am 3. Oktober 1941. Mehrere Millionen sowjetische Soldaten wurden schließlich in deutsche Kriegsgefangenenlager deportiert, von denen die meisten nie lebend zuruckkehrten.

Russische Scharfschutzen verlassen am 27. August 1941 unter Beobachtung deutscher Soldaten ihr Versteck in einem Weizenfeld irgendwo in Russland. Im Vordergrund ist ein zerstörter sowjetischer Panzer zu sehen.

Im November 1941 marschieren deutsche Infanteristen in schwerer Winterausrustung neben Pferdewagen durch einen Bezirk in der Nähe von Moskau. Die winterlichen Bedingungen belasteten die ohnehin schon dunne Versorgungslinie zusätzlich und zwangen Deutschland, seinen Vormarsch zu stoppen. Die Soldaten waren den Elementen und sowjetischen Gegenangriffen ausgesetzt, was zu schweren Verlusten und einem erheblichen Verlust des Kriegsgeschehens fuhrte.